Liquiditätsplanung nach Schweizer Recht
Liquiditätsplanung: Sicherstellen, dass die Firma jederzeit über genügend liquide Mittel verfügt. Dies vermeidet Unternehmenskrisen, die durch Zahlungsunfähigkeit zur Insolvenz führen können. Zudem wird Überliquidität vermieden, da diese recht teuer und ineffizient sein kann.
Das Ausarbeiten und Bewirtschaften der Liquiditätsplanung bildet Teil der Unternehmensführung. Diese kurzfristige Finanzplanung ist Teil der operativen Planung, wobei der Planungshorizont je nach Geschäft von wenigen Tagen bis zu einem Jahr umfasst.
Wesentlich bei der Festlegung des Planungshorizontes ist, dass die verschiedenen Szenarien relativ hohe Eintrittswahrscheinlichkeiten haben.
So kann es beispielsweise bei einer regionalen Bäckerei wenig Sinn machen, die Liquidität für die nächsten 6 Monate zu planen. Ausser, es handelt sich um eine Firma, die stark saisonal abhängige Produkte wie zum Beispiel Fasnachtschüechli herstellt.
Sie sehen am oberen, einfachen Beispiel, dass die Liquidität nicht nur nach Branche oder Region, sondern je Unternehmen höchst individuell auszugestalten ist.
Insofern gibt es hier nur eine einzige Faustregel, die über richtig oder falsch resp. Erfolg oder Insolvenz entscheidet:
Eine saubere Planung der Liquidität stellt sicher, dass dem Unternehmen jederzeit ausreichend, aber nicht zu viel Liquidität zur Verfügung steht.
Wie Liquiditätsplanung funktioniert
Eine gute Liquiditätsplanung ordnet die zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen zeitgerecht ein, deckt mögliche Unterliquidität frühzeitig auf und begegnet dieser durch geeignete Massnahmen.
Die Liquiditätsplaung wird klassischerweise rollierend durchgeführt. Das bedeutet, dass die Planung fortlaufend aktualisiert und den tatsächlich vorherrschenden Bedingungen angepasst werden muss.
Wenn zum Beispiel eine Firma aus der Unterhaltungsindustrie im Dezember 2019 für den April 2020 Liquiditätspläne erstellt hat, mussten man diese aufgrund der Corona-Epidemie bereits im Februar, spätestens aber im März 2020 den tatsächlich eingetretenen Verhältnissen anpassen.
Was genau richtig ist, ist plötzlich zu wenig
Wenn alles rund läuft, ist die Liquidität einer Firma für den laufenden Betrieb optimal eingestellt.
Doch was, wenn unerwartet ein grösserer Auftrag winkt?
Auf einen Schlag wird aus der “guten” Liquidität eine drohende Unterliquidität.
Nehmen wir mal an, die liquiden Mittel sind beispielsweise für die Produktion und den Vertrieb von 1’000 Einheiten ausgelegt.
Nun darf die Firma für einen neuen Grosskunden die Produktion von zusätzlichen 3’000 Einheiten offerieren.
Es leuchtet ein, dass für diesen Auftrag nicht nur ein Vielfaches des benötigten Materials, sondern auch die Produktion der Einheiten ggf. durch zusätzliche Maschinen oder Produktionshallen finanziert werden muss.
Diese zusätzlichen Ausgaben können in unserem Beispiel nicht mit der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.
Unvermittelt wird also einer Liquiditätsplanung, bei der alles genau richtig ist, eine, die zuwenig Mittel vorgesehen hat.
Aktiengesellschaft in der Schweiz
Die Aktiengesellschaft ist die am häufigsten gewählte Rechtsform für Kapitalgesellschaften in der Schweiz. Sie eignet sich für besonders Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf und ist im Schweizerischen Obligationenrecht in den Artikeln 620 bis 763 geregelt.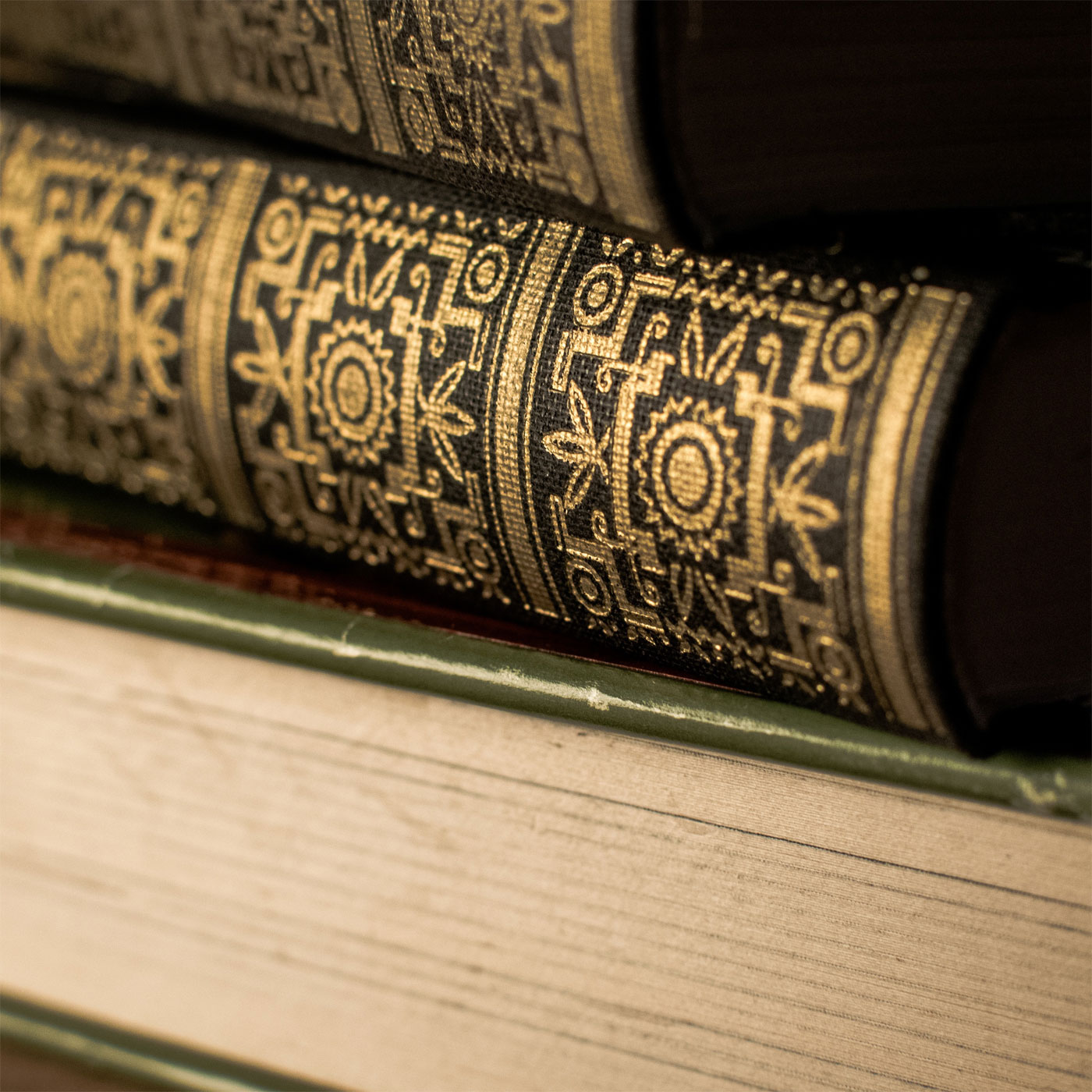
Die Aktiengesellschaft ist in Österreich neben der GmbH eine von zwei österreichischen Formen der Kapitalgesellschaft. Die rechtlichen Grundlagen werden im Aktiengesetz (AktG) geregelt.
Die Aktiengesellschaft besitzt eigene Rechtspersönlichkeit. Konkret heisst das, dass sie Rechte erwerben, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt werden kann. Im Unterschied zu Personengesellschaften (Offene Gesellschaft, Kommanditgesellschaft) kann eine Aktiengesellschaft auch nur durch eine Person errichtet werden.
Das durch die Gesellschafter aufzubringende Grundkapital muss mindestens 70.000 EUR betragen. Bei der Gründung ist mindestens ein Viertel davon einzuzahlen.
Forderungsbevorschussung
Wir kennen die Liquiditäts-Herausforderungen, mit welchen Firmen auch in der Schweiz zunehmend zu kämpfen haben:
Häufig entstehen solche Situationen, obwohl oder gerade, weil das Geschäft wächst. Wir helfen Firmen mit unseren einfachen und verständlichen Lösungen zur Verbesserung der Liquidität.
